Wie können Werkstofftechniker oder Materialprüfer Xing für sich nutzen?
Für alle die (noch) nicht wissen wie Xing funktioniert, hier ein kurzer Überblick:
Xing ist ein fast ausschließlich beruflich-geschäftlich orientiertes soziales Netzwerk. Dort kann man kostenlos in einer Art Visitenkarte eine persönliche Selbstdarstellung hinterlegen. Diese Selbstdarstellung dient natürlich auch dazu, sich einem potenziellen Arbeitgeber als interessanter Mitarbeiter zu präsentieren. Und die Personalabteilungen von Unternehmen machen durchaus Gebrauch davon.
Eine zweite wichtige Säule dieses Netzwerks sind die themenbezogenen Xing-Gruppen.
Dort wird zu speziellen beruflichen Themen und Problemen diskutiert und nicht selten bekommt man wertvolle Tipps und Tricks von Experten – getreu dem Motto: „Ich helfe anderen, und wenn ich eine Frage habe, wird mir geholfen“. Genau diese Gruppen machen Xing natürlich auch für Werkstofftechniker oder Materialprüfer interessant. Ich habe einmal recherchiert und bin dabei auf folgende interessante Gruppen gestoßen:
 Eine der mitgliederstärksten Gruppen mit über 1.800 Mitgliedern in diesem Bereich ist der „Materialsclub“ der DGM (Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.). In dieser starken und aktiven Gruppe werden Fragen der Werkstoffcharakterisierung, Werkstoffentwicklung oder Werkstoffanwendung erörtert. Diese Gruppe sollte man kennen. Es werden in der Kategorie „Allgemeines Fachforum “ nahezu alle Fragen und Anregungen mehrfach kommentiert, was auf eine wirklich lebende Community hindeutet. Als Bonbon gibt es ein Newsletter-Archiv, welches aber identisch mit dem normalen DGM Newsletter ist.
Eine der mitgliederstärksten Gruppen mit über 1.800 Mitgliedern in diesem Bereich ist der „Materialsclub“ der DGM (Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.). In dieser starken und aktiven Gruppe werden Fragen der Werkstoffcharakterisierung, Werkstoffentwicklung oder Werkstoffanwendung erörtert. Diese Gruppe sollte man kennen. Es werden in der Kategorie „Allgemeines Fachforum “ nahezu alle Fragen und Anregungen mehrfach kommentiert, was auf eine wirklich lebende Community hindeutet. Als Bonbon gibt es ein Newsletter-Archiv, welches aber identisch mit dem normalen DGM Newsletter ist.
 Die Gruppe Materialprüfung ist so etwas wie „natürliche Heimat“ aller Fachkräfte für Materialprüfung und Werkstofftechnik. Ebenfalls ein „must have“ für alle, die ernsthaft am Thema interessiert sind und immer auf dem neuesten Stand bleiben möchten. In knapp einem duzend Fachforen widmen sich zwei Foren speziell der zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfung. Also eine wahre Fundgrube für Expertenwissen, zumal die Gruppe mit knapp 1.000 Mitgliedern schon zu den größeren Xing-Gruppen gehört.
Die Gruppe Materialprüfung ist so etwas wie „natürliche Heimat“ aller Fachkräfte für Materialprüfung und Werkstofftechnik. Ebenfalls ein „must have“ für alle, die ernsthaft am Thema interessiert sind und immer auf dem neuesten Stand bleiben möchten. In knapp einem duzend Fachforen widmen sich zwei Foren speziell der zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfung. Also eine wahre Fundgrube für Expertenwissen, zumal die Gruppe mit knapp 1.000 Mitgliedern schon zu den größeren Xing-Gruppen gehört.
 Eine weitere interessante Xing-Gruppe ist die Gruppe Werkstofftechnik(Themen sind Werkstoffcharakterisierung, Werkstoffentwicklung oder Werkstoffanwendung). Sehr gelungen ist hier die fachlich orientierte Teilung des Forums in kleine Foren mit zum Teil schon sehr speziellen Fragen. Hier merkt man allerdings manchmal schon die Absicht, die bei der Gruppengründung Pate stand: „Praktiker der Fertigung mit qualifiziertem Wissen von Hochschulen zusammenbringen“. Auch in dieser Gruppe werden Fragen oder Hinweise häufig und zeitnah kommentiert. Mit über 600 Mitgliedern schon eine beachtliche Größe und eine Gruppe, die sicher noch stark wachsen wird.
Eine weitere interessante Xing-Gruppe ist die Gruppe Werkstofftechnik(Themen sind Werkstoffcharakterisierung, Werkstoffentwicklung oder Werkstoffanwendung). Sehr gelungen ist hier die fachlich orientierte Teilung des Forums in kleine Foren mit zum Teil schon sehr speziellen Fragen. Hier merkt man allerdings manchmal schon die Absicht, die bei der Gruppengründung Pate stand: „Praktiker der Fertigung mit qualifiziertem Wissen von Hochschulen zusammenbringen“. Auch in dieser Gruppe werden Fragen oder Hinweise häufig und zeitnah kommentiert. Mit über 600 Mitgliedern schon eine beachtliche Größe und eine Gruppe, die sicher noch stark wachsen wird.
Neben diesen eher schwergewichtigen Gruppen mit hoher Mitgliederzahl gibt es noch eine ganze Reihe von kleinen fachlich zwar interessanten Xing-Gruppen, allerdings ist hier eine gesunde „Vorsicht“ geboten, denn nicht wenige von diesen kleinen Gruppen haben schon seit längerer Zeit keine aktuellen Beiträge mehr gesehen. Bei meinen Recherchen habe ich Gruppen unter 50 Mitgliedern außen vor gelassen und ebenso Gruppen, in denen seit über 1 Jahr nichts mehr kommuniziert wurde.
Klein aber Fein: In diese Kategorie gehört die Gruppe Wärmebehandlung von Metallen, die sich insbesondere mit der Wärmebehandlung von Stahl befasst, als auch die kleine GruppeZerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Sie sind mit jeweils weniger als 100 Mitgliedern, eher Zwerge in der Xing-Welt. Es lohnt es sich doch auch in diesen Gruppen mal vorbeizuschauen oder Mitglied zu werden, denn oft liegen die Perlen ja gut versteckt in kleinen Nischen.
 Die Xing-Gruppe Gefahrgut in Bezug auf das Thema ADR, da hier in der über 600 Mitglieder starken Gruppe überwiegend Experten der Logistik Branche treffen.
Die Xing-Gruppe Gefahrgut in Bezug auf das Thema ADR, da hier in der über 600 Mitglieder starken Gruppe überwiegend Experten der Logistik Branche treffen.
 Mit 4.600 Mitgliedern ist die Gruppe Schweißenschon eine der bekanntesten Xing-Gruppen und hier tut sich so gut wie jeden Tag etwas. In dieser Gruppe ist die Anzahl der Unterforen schon so groß, wie manch andere Xing Gruppe Mitglieder hat und selbst in Russisch oder Englisch, werden hier Beiträge kommentiert. Für Materialprüfer und Werkstofftechniker ebenfalls eine gute Quelle.
Mit 4.600 Mitgliedern ist die Gruppe Schweißenschon eine der bekanntesten Xing-Gruppen und hier tut sich so gut wie jeden Tag etwas. In dieser Gruppe ist die Anzahl der Unterforen schon so groß, wie manch andere Xing Gruppe Mitglieder hat und selbst in Russisch oder Englisch, werden hier Beiträge kommentiert. Für Materialprüfer und Werkstofftechniker ebenfalls eine gute Quelle.
Xing ist natürlich nicht für Werkstofftechniker oder Materialprüfer entwickelt und ausgelegt worden. Im Gegensatz zu Medien- oder kaufmännischen Berufen sind Berufe, die mit Metall zu tun haben, dort insgesamt etwas unterrepräsentiert. Viele mit Engagement betriebene Blogs und Foren bieten fachlich viel tiefer gehende Informationen und auch lebhaftere Diskussionen. Dennoch ist es nicht verkehrt, in allen genannten Xing-Gruppen regelmäßig vorbei zuschauen – allein schon um an Puls der Zeit zu sein, zu wissen, worüber in der „Szene“ diskutiert wird und auch mal einem anderen „Kollegen“ mit eigenem Wissen oder Erfahrung weiterzuhelfen.

Nachtrag 25. Jan. 2013:
Seit Ende 2012 gibt es die Xing Gruppe „Q+ Weiterbildung in der Materialprüfung und Werkstofftechnik“. Aufgeteilt in verschiedene Foren, können hier bereits berufserfahrene und angehende Experten über die neuesten Entwicklungen in der Werkstofftechnik, Materialprüfung und Wärmebehandlung austauschen. Hinweise auf Seminare und Qualifizierungen unterstreichen den Charakter, das es hier um „Weiterbildung“ im besten Sinne geht. Frei nach dem Motto: Gut qualifizierte und weitergebildete Mitarbeiter stellen die richtigen Fragen und geben die guten Antworten.
Ein weiteres wichtiges Standbein dieser Gruppe ist das Forum: „Stellenangebote“. Hier finden sich Jobangebote aus dem gesamten Bundesgebiet. Alle bestätigten Gruppenmitglieder können auf dieser Plattform selbst Stellenangebote einstellen, was besonders für Firmen der Branchen und Personaldienstleister interessant ist. Können Sie doch hier in Ihrer „richtigen“ Zielgruppe für Jobangebote werben.
Daneben gilt es sich innerhalb der Szene zu vernetzen und sich kennenzulernen. Oft stellen sich Personen und Firmen vor, womit man interessante Einblicke in andere Bereiche erhält. Grundsätzlich gilt, wenn man sich untereinander über Xing vernetzt, kann man sich die Pflege der eigenen Kontakt-Adressdaten sparen, denn schließlich pflegt jeder seine geschäftlichen Kontaktdaten selbst und stellt auch Weiterbildungszertifikate und Zeugnisse in sein Profil ein.
So kann man auch über Jahre hinweg auf einfachste Weise Kontakt halten und jemanden gezielt anschreiben.
Damit wollten wir alle praktischen Vorteile, die Xing bietet, auch für die Materialprüfer, Werkstofftechniker und Wärmebehandler zugänglich machen. In diesem Sinne: Wann treffen wir uns in der Xing-Gruppe?!
Schon in wenigen Tagen nach Gründung, knackte diese Gruppe bereits die 100 Mitgliedergrenze und sie wächst immer noch. Also, in dieser Gruppe zu sein lohnt sich.
Categories TrainingCenter, Weiterbildung
weiterlesen



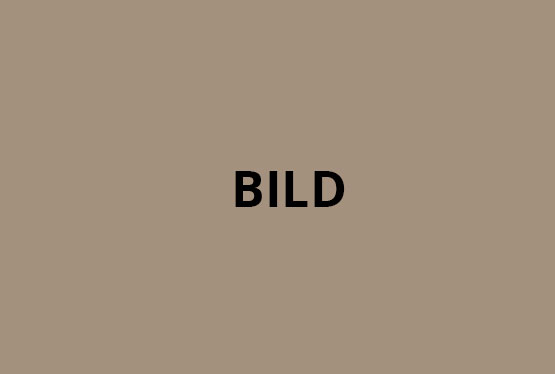
 Zusammenfassende Darstellung von Konformitätsbewertungsstellen, Konformitätsbewertungen und Konformitätserklärungen
Zusammenfassende Darstellung von Konformitätsbewertungsstellen, Konformitätsbewertungen und Konformitätserklärungen Gegenüberstellung von Inspektion und Schadensanalyse als „Rückwärts-Inspektion“
Gegenüberstellung von Inspektion und Schadensanalyse als „Rückwärts-Inspektion“









